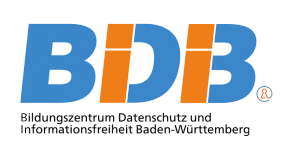Stuttgart, 2. Februar 2009
Pressemitteilung
2008 – ein Jahr des Datenschutzes?
Landesbeauftragter Zimmermann: „Aus Skandalen Lehren ziehen!“
In einer Bilanz für das vergangene Jahr stellte der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Peter Zimmermann, fest, dass der Datenschutz bundesweit ein zentrales Thema gewesen sei. Leider hätte es erst handfester Skandale etwa im Umgang mit Telefondaten oder bei den Praktiken der Mitarbeiterüberwachung bedurft, um vielen Bürgern bewusst zu machen, wie bedeutsam der Datenschutz für das alltägliche Leben sein kann.
Der öffentliche Bereich sei im Land von vergleichbaren spektakulären Massenvorkommnissen zwar verschont geblieben. Peter Zimmermann: „Man darf aber nicht die Augen davor verschließen, dass auch hier deutliche Defizite im Datenschutz festzustellen sind.“ Es sei als Konsequenz aus den skandalösen Ereignissen richtig und überfällig gewesen, dass mittlerweile das Personal bei der nicht-öffentlichen Datenschutzaufsicht im Innenministerium verstärkt worden ist. Hierbei dürfe man aber nicht stehen bleiben. Wenn seine Behörde auch in Zukunft den ständig steigenden Anforderungen einigermaßen gerecht werden solle, müsse auch der öffentliche Bereich des Datenschutzes personell verstärkt werden. Zimmermann: „Am besten wäre es allerdings, die schon seit Jahren immer wieder von mir angemahnte Zusammenlegung der Datenschutzaufsicht im öffentlichen und im nicht-öffentlichen Bereich endlich zu vollziehen. Denn nur mit einer modernen und schlagkräftigen Organisation wird der Datenschutz mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik Schritt halten und die von ihm erwarteten Kontroll- und Beratungsaufgaben wirksam wahrnehmen können.“
Im Bereich der Gesetzgebung habe das Bundesverfassungsgericht auch im Jahr 2008 wieder korrigierend eingreifen müssen. Mit der Entscheidung zur Online-Durchsuchung vom 27. Februar 2008 habe das Bundesverfassungsgericht fast genau 25 Jahre nach seinem legendären Volkszählungsurteil den Grundrechtsschutz im Datenschutz weiterentwickelt. Neben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei nunmehr ein „Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“ getreten, womit das Bundesverfassungsgericht den Schutz der Persönlichkeitsrechte auf Augenhöhe mit der rasch fortschreitenden Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik und den damit für die Freiheitsrechte verbundenen Gefahren bringen wolle.
Die gleichfalls richtungweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur polizeilichen Kfz-Kennzeichenerfassung habe unmittelbare Auswirkungen auch auf die Gesetzgebungsarbeit in Baden-Württemberg gehabt. Peter Zimmermann: „Der ursprüngliche Entwurf des Innenministeriums zur Änderung des Polizeigesetzes, mit dem auch im Land die automatisierte polizeiliche Kfz-Kennzeichenerfassung eingeführt werden sollte, befand sich auf direktem Marsch in die Verfassungswidrigkeit. Trotz meiner in der Anhörung vorgebrachten massiven verfassungsrechtlichen Bedenken meinte das Innenministerium zunächst, diese ignorieren zu können. Erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts veranlasste die Landesregierung, den Gesetzentwurf nachzubessern, wobei immer noch fraglich ist, ob die automatisierte Kfz-Kennzeichenerfassung überhaupt dazu geeignet ist, die aus polizeilicher Sicht gehegten Erwartungen zu erfüllen.“
Der Landesdatenschutzbeauftragte mahnte Augenmaß bei etwaigen weiteren gesetzlichen Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte an. Es müsse gesetzgeberisch nicht alles umgesetzt werden, was gerade eben noch verfassungsrechtlich zulässig sei. So halte er es für vernünftig, im Land auch weiterhin auf eine gesetzliche Regelung zur Online-Durchsuchung zu verzichten, da überaus fraglich sei, ob der mit einer solchen Maßnahme zwangsläufig verbundene tiefgreifende Eingriff in die Freiheitsrechte wirklich die immer behaupteten existenziell notwendigen Erkenntnisse für die Terrorismusbekämpfung bringe.
Zu folgenden Themen sind jeweils nähere Informationen angeschlossen:
- Auswirkungen des neuen Polizeigesetzes auf den Prüfstand stellen
- Neues Versammlungsrecht demokratiefreundlich gestalten
- Videoüberwachung – Allheilmittel für alle Lebenslagen?
- Einschulungsuntersuchung mit rechtlichen Mängeln
- Datenschutz an Schulen verbesserungswürdig
- Die Landwirtschaft, Europa und der Datenschutz
- Auch Umweltschutz muss datenschutzgerecht praktiziert werden
- Auswirkungen des neuen Polizeigesetzes auf den Prüfstand stellen
- Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur Novellierung des Polizeigesetzes konnten die gröbsten verfassungsrechtlichen Mängel zwar noch behoben werden. Gleichwohl bedeutet die im November 2008 verabschiedete Änderung des Polizeigesetzes unter datenschutzrechtlichen Aspekten einen weiteren Schritt in den Präventionsstaat, der eine erneute Beschneidung bürgerlicher Freiheitsrechte zur Folge hat.Exemplarisch hierfür stehen die Ausweitung der Voraussetzungen für eine Videoüberwachung durch den Polizeivollzugsdienst und die Ortspolizeibehörden, die Einführung der automatischen Kennzeichenerfassung und die erweiterten Speicherungsmöglichkeiten des Polizeivollzugsdienstes für die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten.Während in der Vergangenheit Voraussetzung für eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze und Straßen ein Kriminalitätsbrennpunkt war, reicht nunmehr aus, dass sich die Kriminalitätsbelastung an einem öffentlich zugänglichen Ort deutlich von der des Gemeindegebiets abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist. Damit kann in erheblich mehr Fällen eine Videoüberwachung ermöglicht werden als bisher. Ob man damit dem Ziel einer Verbesserung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wirklich näher kommt, ist vor dem Hintergrund der personellen Engpässe bei Polizei und den anderen öffentlichen Stellen zu bezweifeln. Wenn eine Videoüberwachung wirklich Wirkung erzeugen soll, bedarf es – wie in Mannheim zunächst in der Innenstadt und nunmehr am Hauptbahnhof – einer permanenten Kontrolle des Geschehens an Bildschirmen durch erfahrene Beamte des Polizeivollzugsdienstes und zivilen Einsatzkräften in diesen Bereichen, um sofort einschreiten zu können. Die Auswertung von Aufzeichnungen nach einem polizeirelevanten Geschehen ist demgegenüber mit erheblich höheren und wahllosen Eingriffen in das informationelle Selbstbestimmungsrecht vieler Passanten verbunden und kann häufig nur dazu dienen, den Zeitraum eines relevanten Geschehens und vielleicht auch einen Urheber zu erfassen.
Der Einsatz automatischer Kennzeichenlesesysteme ist nunmehr in einer außerordentlich ausführlichen Regelung zugelassen worden. Es hatte allerdings einige Zeit gebraucht, bis das Innenministerium bei der Erarbeitung des Entwurfs die Schlussfolgerungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den verfassungswidrigen Regelungen im hessischen und schleswig-holsteinischen Polizeirecht realisierte. Ob die Maßnahme wirklich die erwarteten durchschlagenden Erfolge bei der Gefahrenabwehr und der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten haben wird, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Auswertungen des Einsatzes in Hessen ließen nach Presseberichten jedenfalls den Schluss zu, dass die geringe Zahl an Trefferfällen vor allem Fahrzeughalter betrafen, die ihre Haftpflichtversicherungsprämien nicht gezahlt hatten. Der Gewinn derart bescheidener Erkenntnisse würde den Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht unzähliger Personen, die ein solches aktives System passieren, aber nicht rechtfertigen können.
Ein ganz erheblicher Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist in der Regelung enthalten, die es dem Polizeivollzugsdienst ermöglicht, Daten aus Ermittlungsverfahren zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten zu speichern. Schon der nur ansatzweise Verdacht einer Straftat – auch von Bagatelldelikten – führt zu einer Aufnahme der Erkenntnisse in die polizeilichen Dateien. Dies soll als „Prüffall“ generell erst einmal für zwei Jahre erfolgen. Solche Vorgänge sind bei Abrufen aus dem polizeilichen Informationssystem für alle Dienststellen im Land verfügbar. Dies bedeutet, dass möglicherweise unzutreffende Daten zwei Jahre genutzt werden können, bis sie gelöscht werden müssen, weil es doch keine Anhaltspunkte für die Begehung weiterer Straftaten gegeben hat. Der Bürger wird damit sozusagen vorbeugend auf zwei Jahre unter Verdacht gestellt, ohne dass wirklich valide Erkenntnisse über den Verdacht einer Straftat vorliegen.
Insgesamt wird zu beobachten sein, ob
- die Videoüberwachung tatsächlich nicht eine nach dem Gesetzeswortlaut mögliche erhebliche Ausweitung erfährt, die nach Aussagen des Innenministeriums aber angeblich nicht angestrebt wird,
- die automatisierte Kfz-Kennzeichenerfassung eine Maßnahme ist, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht wird, und
- die präventive Speicherung von Bürgerdaten mit dem notwendigen Augenmaß betrieben wird.
- Neues Versammlungsrecht demokratiefreundlich gestalten
- Der Entwurf des Landesversammlungsgesetzes, der von verschiedenen Seiten schon deutlich kritisiert wurde, ist offensichtlich in erster Linie an den polizeilichen Bedürfnissen nach Ordnung und Sicherheit orientiert und wird der verfassungsrechtlichen Bedeutung der Versammlungsfreiheit nicht gerecht. Der Entwurf bedarf auch nach Auffassung des Datenschutzes einer Überarbeitung in verschiedenen Punkten.Auf Anforderung der Versammlungsbehörde sollen personenbezogene Daten der Ordner von Versammlungen mitgeteilt werden. Dabei bleibt unklar, wann eine solche Anforderung als erforderlich anzusehen ist und welche Maßstäbe für die Eignung oder Nichteignung von Ordnern gelten sollen. Diese umfassende präventive Datenerhebung erschwert die grundrechtlich geschützte Durchführung von Versammlungen, ohne dass dies durch ein überwiegendes Sicherheitsbedürfnis zu rechtfertigen wäre.Die Regelungen zur Datenverarbeitung sind ebenfalls überarbeitungsbedürftig. Nach den Regelungen zur verdeckten Datenerhebung sollen – für Versammlungen in geschlossenen Räumen verfassungsrechtlich höchst bedenklich – Aufklärungen im Vorfeld ermöglicht werden. Wenn Hinweise auf gewalttätige Vorgänge im Vorfeld bereits bekannt sind, mangelt es an der Notwendigkeit für eine verdeckte Datenerhebung; wenn diese Hinweise fehlen, ist kein Anlass für eine verdeckte Datenerhebung gegeben. – Desgleichen ist die Regelung zur nachträglichen Unterrichtung von Betroffenen über derartige Datenerhebungen zu kritisieren, die erst dann erfolgen soll, „soweit der Verwendungszweck nicht gefährdet ist“. Dies führt nach allen Erfahrungen eher dazu, dass es praktisch häufig zu keiner Unterrichtung kommen dürfte, was grundsätzlich nicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar ist.
Die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen und deren Verwendung würde ebenfalls zu weit gehen. Die Anfertigung bei Versammlungen in geschlossenen Räumen ist zwar gegenüber denen bei Versammlungen unter freiem Himmel an engere Voraussetzungen geknüpft. Allerdings ist die Möglichkeit, diese für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten jeglicher Art, also auch von einfachsten Ordnungsverstößen, nutzen zu dürfen, zu kritisieren. Selbst nach dem Polizeigesetz dürfen derartige Aufzeichnungen nur für die Verfolgung erheblicher Ordnungswidrigkeiten genutzt werden. Eine unbegrenzte Nutzung von nicht anonymisierten Aufzeichnungen für Aus- und Fortbildungszwecke ist gleichfalls verfassungsrechtlich fragwürdig.
Insgesamt sollte der Gesetzentwurf – wie im Übrigen auch von anderer Seite vielfach gefordert – gründlich überarbeitet werden.
- Videoüberwachung – Allheilmittel für alle Lebenslagen?
- Videoüberwachung kann eine wirksame und auch unter Datenschutzgesichtspunkten zu akzeptierende Maßnahme sein, sofern sie gezielt und unter strikter Beachtung der Persönlichkeitsrechte der Bürger eingesetzt wird. Häufig ist jedoch festzustellen, dass Videoüberwachung reflexartig als Sicherheits-Placebo missbraucht wird. Videoüberwachung ist jedoch nur begrenzt in der Lage, die hohen Erwartungen an eine Steigerung der Sicherheit wirklich zu erfüllen.Grundsätzlich ist daran zu erinnern, dass die Videoüberwachung, vor allem wenn sie mit einer Aufzeichnung verbunden ist, nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007 einen ganz erheblichen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und damit in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der davon erfassten Personen darstellt. Bereits im Mai 2007 ist das Innenministerium vom Landesbeauftragten darauf hingewiesen worden, dass es auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen einer ausreichenden bereichsspezifischen Rechtsgrundlage bedarf. Für eine Vielzahl von der öffentlichen Hand betriebener Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Hallenbäder oder Krankenhäuser fehlen bis heute die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für den Betrieb einer Videoüberwachung. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist im Innenministerium seit längerem in Arbeit; zu diesem hat der Landesbeauftragte mit einigen Änderungsvorschlägen Stellung genommen. Will man Videoüberwachung in den bisher nicht gesetzlich geregelten öffentlichen Bereichen zulassen, muss den vom Bundesverfassungsgericht vor nunmehr zwei Jahren formulierten Anforderungen endlich Rechnung getragen werden.Ein Beispiel für einen missglückten Umgang mit den sich mit einer Videoüberwachung stellenden rechtlichen Fragestellungen ist die bereits im Jahr 2004 gerichtlich verhinderte polizeiliche Videoüberwachung im Zusammenhang mit dem örtlichen Schützenfest in Biberach. Erst nach längerer, zum Teil auch öffentlich geführter Diskussion hat die Stadt die rechtlichen Grenzen einer Videoüberwachung akzeptiert. Auf dem Festgelände sollte durch eine Verlagerung der Verantwortlichkeit auf einen privatrechtlichen Verein eine Videoüberwachung 2008 erneut realisiert werden. Öffentliche Aufgaben der Stadt als Ortspolizeibehörde können aber nicht ohne Weiteres auf einen Verein delegiert werden. Dies hat das für die Datenschutzaufsicht im nicht-öffentlichen Bereich zuständige Innenministerium mittlerweile in erfreulicher Deutlichkeit klargestellt. Wie einer vor kurzem bekannt gewordenen Pressemitteilung zu entnehmen war, sieht die zuständige Polizeidirektion nunmehr auch für das Jahr 2009 keine Notwendigkeit für eine Videoüberwachung des Festgeschehens auf dem Biberacher Gigelberg.
Ebenso befasste sich der Landesdatenschutzbeauftragte mit der Videoüberwachungspraxis an Mannheimer Schulen. Hierzu wurde von ihm auch mit Blick auf andere öffentliche Schulen in Baden-Württemberg klargestellt, dass der aktuelle Betrieb von Videoüberwachungsanlagen an öffentlichen Schulen mit einer Aufzeichnung des Bildmaterials derzeit in jedem Fall rechtswidrig ist. In Kenntnis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts installierte Videoüberwachungen stellen einen offenen Rechtsbruch dar und müssen sofort abgeschaltet werden. Aber auch Videoüberwachungen mit Aufzeichnungsmöglichkeit, die vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ohne spezielle gesetzliche Grundlage installiert wurden, können nicht auf Dauer ohne die erforderliche Rechtsgrundlage weiterbetrieben werden. Konsequenterweise hat die Stadt Mannheim mittlerweile nach Pressemeldungen 13 an dortigen Schulen betriebene Anlagen abgeschaltet.
- Einschulungsuntersuchung mit rechtlichen Mängeln
- Das Amt des Landesbeauftragten befasste sich 2008 zum wiederholten Mal mit der Neukonzeption der Einschulungsuntersuchung. Im Rahmen der dabei gebotenen Beteiligung übersandte das Kultusministerium dem Datenschutzbeauftragten einen Gesetzentwurf, mit dem u. a. Vorschriften über eine so genannte Sprachstandsdiagnose im Schulgesetz verankert werden sollten. Die vorgesehene gesetzliche Regelung sollte dazu ermächtigen, dass eine Sprachstandsdiagnose durchgeführt wird. Welchem Ziel die Sprachstandsdiagnose dienen soll und welche Kriterien der Sprachstandsdiagnose zugrunde zu legen sind, war im Gesetzentwurf selbst nicht einmal ansatzweise zu finden, sondern sollte einer gemeinsamen Regelung des Kultus- und des Sozialministeriums durch eine einfache Verwaltungsvorschrift vorbehalten bleiben. Dies widerspricht dem verfassungsrechtlichen Gebot einer eindeutigen gesetzlichen Regelung, aus der die rechtliche Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler und gegebenenfalls auch anderer Beteiligter unmittelbar erkennbar ist. Die wesentlichen Bestimmungen zu Inhalt und Grenzen der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen im Gesetz selbst getroffen werden. Es ist mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Prinzip vom Vorbehalt des Gesetzes schlechterdings unvereinbar, solche Bestimmungen einer Verwaltungsvorschrift vorzubehalten.Hierauf hatte der Landesbeauftragte für den Datenschutz in seiner Stellungnahme gegenüber dem Kultusministerium ausdrücklich hingewiesen. Diesen Hinweis berücksichtigte das Kultusministerium jedoch nicht und versäumte es auch, den Landtag im weiteren Verlauf des inzwischen abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens über die grundsätzlichen Bedenken des Landesbeauftragten mit der gebotenen Deutlichkeit zu informieren. Bei der Anhörung zu dem inzwischen ausgearbeiteten Entwurf einer Verwaltungsvorschrift zur Durchführung einer Sprachstandsdiagnose in Verknüpfung mit der Einschulungsuntersuchung erneuerte der Landesbeauftragte seine massiven grundsätzlichen Rechtsbedenken und wies zum wiederholten Mal auf die fehlende gesetzliche Grundlage für eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Sprachstandsdiagnose hin. Das Kultusministerium hat es nicht für nötig befunden, hierauf zu reagieren. Stattdessen ist die Verwaltungsvorschrift mit Wirkung vom 10. Januar 2009 in Kraft gesetzt worden. Damit ist einer rechtswidrigen Verarbeitung von nicht unsensiblen Daten im Rahmen der Einschulungsuntersuchung Tür und Tor geöffnet.Zurück zur Übersicht.
- Datenschutz an Schulen verbesserungswürdig
- In mehrfacher Hinsicht befasste sich das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz (über die unter 3. abgehandelte Thematik der Videoüberwachung hinaus) mit der Datenschutzsituation an Schulen. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Nutzung des Internets. Dies kann jedenfalls dann brisant werden, wenn es um die Offenlegung personenbezogener Daten geht.So waren auf der Internetseite einer Schule beispielsweise Briefe an die Eltern der Schüler zu lesen, u. a. mit Namen und Unterrichtsfächern von neuen Kollegen. Außerdem hieß es dort: „In diesen Wochen wurden“ zwei namentlich genannte Lehrerinnen „mit Beginn der Mutterschutzfrist beurlaubt“. Solche schutzbedürftigen Daten haben aber im Internet nichts zu suchen. Das sah auch das Kultusministerium auf die förmliche Beanstandung des Landesdatenschutzbeauftragten hin so. Besonders schwer wog der Rechtsverstoß dieser Schule, weil ihre Internetseite bereits im Jahr 2007 aufgefallen war. Der Landesdatenschutzbeauftragte hatte die Schule damals u. a. auf Anforderungen an das Veröffentlichen personenbezogener Lehrerdaten und auf das Erfordernis der Einwilligungen der betroffenen Lehrer hingewiesen.Probleme bereitete auch ein an Gymnasien zur Oberstufenverwaltung eingesetztes IT-Verfahren. Dieses verfügt über so genannte Jahrgangspakete, die – verschlüsselt – u. a. die Noten aller Schüler eines Jahrgangs enthalten. Sinn der Sache war es eigentlich, dass jeder Schüler Zugriff nur auf seine eigenen Daten haben sollte. Bei einer Kontrolle zeigte sich jedoch, dass die dazu erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen unzulänglich waren. Denn Benutzername und Passwort waren leicht zu erraten, weil die Regeln für deren Bildung im Anwenderhandbuch über das Internet frei abrufbar waren. Zudem konnte durch simples, wiederholtes Ausprobieren das Passwort mit etwas Zeitaufwand geknackt werden. Die seit langem bekannte und bewährte automatische Sperrung nach einer bestimmten Anzahl von Fehleingaben, wie man sie z.B. von Bankkarten her kennt, war nämlich nicht vorhanden. Durch Beachten aktueller Passwortkonventionen, auf die auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz seit Jahren hinweist, wäre diese Unzulänglichkeit zu verhindern gewesen. Erfreulicherweise wurde dieser Missstand auf den Hinweis des Datenschutzbeauftragten hin schnell beseitigt.
An anderen Gymnasien waren Abiturprüfungspläne u. a. mit Schülernamen und allen Prüfungsfächern über das Internet weltweit abrufbar. Auch das war datenschutzrechtlich natürlich nicht zulässig.
Diese Beispiele machen deutlich, dass Schulen ihrer Pflicht zum verantwortungsvollen Umgang mit elektronischen Medien mitunter keineswegs gerecht werden. Denn die etwa mit dem Internet verbundenen enormen Gefahren werden meist nicht ausreichend berücksichtigt. Der Eindruck drängt sich auf, dass das hierfür erforderliche Bewusstsein, aber auch das Know-how an so mancher Schule nicht vorhanden ist.
Die Informationen aus dem Schulbereich zeigen auch immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler mit dem verführerischen Internetangebot nicht immer verantwortungsvoll umgehen können. Soziale Netzwerke wie SchülerVZ oder StudiVZ tragen zwar einem offensichtlich grundlegenden Bedürfnis nach gegenseitigem Informationsaustausch Rechnung; die Gefahren, die mit einer allzu großzügigen Offenlegung teils sehr intimer Daten verbunden sind, werden häufig aber unterschätzt oder gar nicht erkannt. Insofern wäre es wünschenswert, an den Schulen nicht nur die technische Kompetenz im Umgang mit dem Internet zu vermitteln, sondern im Zusammenhang hiermit auch die Fähigkeit, die in der Internetnutzung liegenden Gefahren für die eigenen Persönlichkeitsrechte zu erkennen.
- Die Landwirtschaft, Europa und der Datenschutz
- Mit einem Informationsschreiben vom 10. November 2008 hat sich das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum an die baden-württembergischen Landwirte gewandt und diese darüber unterrichtet, dass beabsichtigt sei, in einem gestuften Verfahren ab Mitte Dezember 2008 bzw. Ende April 2009 personenbezogene Daten über alle diejenigen Landwirte in das Internet zu stellen, die im Jahr 2007 Beihilfen aus den europäischen Agrarfonds ELER und EGFL erhalten haben. Veröffentlicht werden sollen unter einer frei zugänglichen Web-Adresse (www.agrar-fischerei-zahlungen.de) nicht nur Name und Wohnort der Mittelempfänger, sondern auch Angaben zur Höhe der jeweils bezogenen Zahlungen.Hierbei muss man wissen, dass der Löwenanteil der Förder- und Ausgleichszahlungen, die die baden-württembergischen Landwirte im Rahmen verschiedener Programme beantragen können, aus einem der genannten beiden EU-Töpfe kofinanziert wird. Entsprechend groß ist der Kreis der von der avisierten Internetveröffentlichung Betroffenen.Die Ankündigung des Ministeriums hat bei vielen Mittelempfängern für verständliche Aufregung gesorgt – wer legt schon gerne aller Welt seine persönlichen Einkommensverhältnisse offen? Mehrere Betroffene haben sich deshalb an den Landesbeauftragten für den Datenschutz gewandt und diesen gebeten, gegen die Veröffentlichung ihrer Daten einzuschreiten. Leider besteht im Ergebnis hierfür jedoch keine Handhabe; denn es existieren einschlägige gemeinschaftsrechtliche Vorgaben, die dem Land gar keine andere Wahl lassen, als gemäß der Ankündigung des Ministeriums zu verfahren.
Die unscheinbare Ursache des Verdrusses ist ein Artikel 44a der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 zur Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik, der dort erst im Jahr 2007 im Zuge der so genannten europäischen Transparenzinitiative eingefügt worden ist. Dieser Artikel 44a verpflichtet die Mitgliedstaaten, jedes Jahr nachträglich Informationen über die Empfänger von Mitteln aus den beiden Fonds sowie über die Beträge, die der jeweilige Empfänger erhalten hat, zu publizieren. Nähere Bestimmungen zu Medium, Inhalt und Dauer dieser Veröffentlichung – die in das Netz zu stellenden Angaben sollen jeweils zwei Jahre lang auf der Website zugänglich bleiben – trifft ein weiterer gemeinschaftsrechtlicher Rechtsakt jüngsten Datums, nämlich die Durchführungs-Verordnung (EG) Nr. 259/2008 der Kommission vom 18. März 2008. Ergänzend hierzu hat der Bundesgesetzgeber ein „Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz“ erlassen, das der innerstaatlichen Umsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben dient.
Zwar ist überaus zweifelhaft, ob die europarechtlichen Regelungen den nationalen Datenschutzstandards in Deutschland gerecht werden. Ein Eingreifen durch den Landesdatenschutzbeauftragten ist allerdings nicht möglich, da es sich hier um verbindliches Gemeinschaftsrecht handelt, über das man sich national nicht hinwegsetzen kann. Dem Vernehmen nach gibt es aber in einem anderen Bundesland bereits Klagen Betroffener gegen die Veröffentlichung ihrer Daten. Die weitere Entwicklung bleibt daher abzuwarten.
- Auch Umweltschutz muss datenschutzgerecht praktiziert werden
- Internetaktivitäten wie Google-Streetview oder Google-Earth haben in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass auch Daten außerhalb des internen Wohnungsbereichs nicht völlig ungeschützt sein dürfen. Dies gilt auch dann, wenn eine Datenverarbeitung für einen „guten“ (Umwelt-)Zweck erfolgen soll. Dies belegt folgender Vorgang:Von Seiten einer baden-württembergischen Kommune erreichte den Landesbeauftragten für den Datenschutz die vorsorgliche Anfrage, ob einer Veröffentlichung von kartografischen Darstellungen oder Luftbildaufnahmen ihres Gemeindegebietes, auf denen gebäudescharf in einer vereinfachten Klassifikation das Solarenergiepotential eines jeden Gebäudedachs ausgewiesen werden sollte, datenschutzrechtlichen Bedenken begegne. Die Kommune beabsichtigte, nach dem Vorbild der Stadt Osnabrück eine solche Darstellung als Informationsservice für ihre Bürger in ihren Internetauftritt einzustellen.Im Zuge weiterer Recherchen stellte sich heraus, dass dem Vorhaben ein Projekt der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) zugrunde liegt, die im Auftrag des Umweltministeriums ein entsprechendes Verfahren zur Darstellung des Solarenergiepotentials von Gebäudedaten entwickelt hat und dieses potenziellen Interessenten (Regionalverbänden, Kreisen und Gemeinden) zur Verfügung stellt. Die notwendigen Berechnungen sollen nach der Konzeption des Projekts private dritte Dienstleister im Auftrag des jeweiligen Interessenten erbringen, während die LUBW geeignete Schnittstellen für die Übernahme der Berechnungsergebnisse anbietet sowie Beratungsleistungen erbringt.
Sicherlich kann man sich in Zeiten eines prognostizierten dramatischen Klimawandels auf den Standpunkt stellen, dass die Förderung der Verbreitung regenerativer Energien ein unterstützenswertes Anliegen ist. Aus datenschutzrechtlicher Warte ist gleichwohl kritisch zu fragen, ob der Bürger es deshalb hinnehmen muss, dass Angaben über eine mögliche Nutzung seines privaten Gebäudeeigentums ohne seine Einwilligung und sein Zutun über das Internet gleichsam weltweit jedermann zugänglich gemacht werden. Mit dem neugierigen Nachbarn, der virtuell nach „Öko-Verweigerern“ in seinem Viertel fahndet, wird er ebenso rechnen müssen wie mit offensiver Werbung der Hersteller und Vertreiber von Photovoltaik-Anlagen, die eine solche Internetpräsentation sicherlich nutzen werden, um neue Kunden zu gewinnen. Manchem Betroffenen wird dies keinesfalls willkommen sein.
Aus den vorgenannten Erwägungen hat sich der Landesdatenschutzbeauftragte zunächst skeptisch zu dem Projekt geäußert, zumal die Frage nach einer belastbaren Rechtsgrundlage des Vorhabens im Raum stand. Das Umweltinformationsgesetz des Bundes – das in Baden-Württemberg in weiten Teilen entsprechend anwendbar ist – sieht allerdings in der Tat nicht nur die Mitteilung von Umweltinformationen auf Antrag, sondern auch deren antragsunabhängige aktive Verbreitung per Internet vor. Soweit die für die Veröffentlichung vorgesehenen Daten jedoch einen Personenbezug aufweisen, müsste nach den im Umweltinformationsgesetz selbst enthaltenen bereichsspezifischen Bestimmungen zum Datenschutz grundsätzlich eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden; im Rahmen einer Massenveröffentlichung gleichartiger Daten erscheint dies schlechterdings nicht möglich.
Der Landesdatenschutzbeauftragte sieht einen möglichen Kompromiss darin, dass den betroffenen Grundstückseigentümern das Recht eingeräumt wird, der Veröffentlichung der ihr Grundeigentum betreffenden Angaben zu widersprechen. Auf diese Widerspruchsmöglichkeit muss im Rahmen des Internetauftritts der veröffentlichenden Stelle und im Zuge der allgemeinen Werbung für das Projekt deutlich hingewiesen werden. Damit könnte dem informationellen Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Eigentümer angemessen Rechnung getragen werden, ohne die Realisierung des an sich unterstützenswerten Vorhabens zu gefährden.