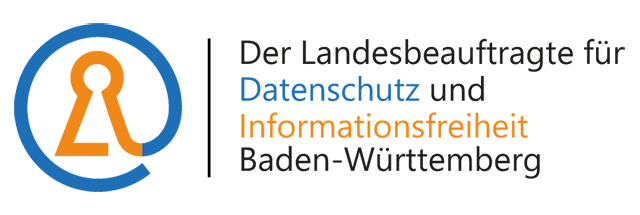Inhalt
Stand: Februar 2020
Richtlinie des LfDI zur Nutzung von Sozialen Netzwerken durch öffentliche Stellen (2017, überarbeitet 2020)
I. Worum geht es?
1. Soziale Netzwerke – anscheinend unverzichtbar
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram sind zu einem wesentlichen Bestandteil des beruflichen und privaten Informations- und Kommunikationsverhaltens vieler Bürgerinnen und Bürger geworden. Auch öffentliche Stellen nutzen vermehrt Soziale Netzwerke oder planen dies für die Zukunft: Sicherheitsbehörden möchten via Twitter aktuelle Kurzhinweise an Teilnehmer von Versammlungen geben, Kommunen über Facebook auf ihr touristisches Angebot hinweisen und Anfragen dazu beantworten, und nicht wenige Behörden rekrutieren ihren Nachwuchs über Soziale Netzwerke.
Die vorliegende Richtlinie zielt in erster Linie auf die Nutzung Sozialer Netzwerke zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit und der Bereitstellung allgemeiner Informationen der Verwaltung (Aufgaben, Leistungen, Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Ansprechpartner, Hinweise auf Veranstaltungen, Diskussionsmoderation etc.), nicht aber zur Bereitstellung bzw. zum Bezug konkreter Verwaltungsleistungen. Diese Aspekte regeln die bestehenden oder noch zu schaffenden E-Government-Gesetze.
2. Grenzen der Nutzung durch öffentliche Stellen
Während die Nutzung Sozialer Netzwerke durch die Bürger in deren Belieben gestellt ist, unterliegen öffentliche Stellen insoweit vielfältigen gesetzlichen Bindungen und haben zudem eine rechtsstaatlich begründete Vorbildfunktion. Hierauf haben Datenschützer immer wieder warnend hingewiesen, wurden damit aber (zu) selten gehört. Mit der jetzt vorgelegten Orientierungshilfe soll dem Nutzungsinteresse der öffentlichen Stellen ebenso Rechnung getragen werden wie den für öffentliche Stellen bestehenden datenschutzrechtlichen Grenzen.
3. Um Messenger geht’s hier nicht
Der Fokus dieser Richtlinie liegt also auf Sozialen Netzwerken, die sich als Plattformen an die Öffentlichkeit richten. Die Nutzung sog. Instant-Messaging-Dienste wie etwa WhatsApp, Snapchat und des Facebook-Messengers unterliegt strengeren Voraussetzungen – gerade in den Fällen, in denen zwischen Staat und Nutzern eine besondere Schutz- und Obhutsbeziehung besteht, wie etwa im Bereich von Kindergärten oder Schulen – und ist daher nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
4. Juristisch betrachtet …
Bei Sozialen Netzwerken handelt es sich rechtlich um Telemedien nach § 1 Abs. 1 des Telemediengesetzes (TMG). Aufgrund der entstandenen zeitlichen Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren zum Erlass der ePrivacy-Verordnung und der teilweise nicht hinreichenden Umsetzung der alten ePrivacy-Richtlinie ist die DS-GVO jedoch im Bereich von Kapitel 4 des TMG vorrangig anzuwenden und verdrängt dessen Vorschriften (siehe dazu die Positionsbestimmung der DSK „Zur Anwendbarkeit des TMG für nicht-öffentliche Stellen ab dem 25. Mai 2018“).
Bei Sozialen Netzwerken handelt es sich vielfach um gestufte Anbieterverhältnisse, bei denen der jeweilige Informations- oder Kommunikationsdienst auf einer Plattform angeboten wird. Dem Nutzer stehen also der jeweilige Inhalteanbieter, der die Plattform nutzt, um sich zu präsentieren, dort Inhalte zu posten oder zu kommentieren (darunter fallen nunmehr auch öffentliche Stellen), und der jeweilige Plattformbetreiber gegenüber. Dies macht Soziale Netzwerke aus Nutzerperspektive schwer durchschaubar und aus rechtlicher Sicht häufig problematisch, gerade im Hinblick auf datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten. Insbesondere im Fall außereuropäischer Plattformbetreiber/-anbieter sind grundlegende Rechtsfragen letztlich nicht geklärt.
Vorgaben etwa des Wettbewerbsrechts, des Vergaberechts oder besondere öffentlich-rechtliche Bindungen von Behörden sind nicht Gegenstand dieser Richtlinie. Dass es hier weitere Regeln für öffentliche Stellen zu beachten gilt, etwa bei der vertraglichen Anbindung an Monopolisten im Bereich der Internet-Kommunikation, liegt auf der Hand. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) sieht jedenfalls eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung öffentlicher Stellen, die Soziale Netzwerke im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung einsetzen, da erst durch deren Angebote in Sozialen Netzwerken entsprechende Nutzungsdaten entstehen, die vom jeweiligen Plattformbetreiber verarbeitet werden können. Aus dieser Verantwortung ergeben sich Rechtspflichten der öffentlichen Stellen (dazu sogleich unter II.).
5. Was genau bedeutet das?
Auch bei der Nutzung Sozialer Netzwerke durch öffentliche Stellen gilt also: keine Chance ohne Grenzen. Staatliche und kommunale Stellen unterliegen einer verfassungsrechtlichen Bindung an Recht und Gesetz (Rechtsstaatsprinzip) und stehen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Vorbildfunktion in einer besonderen Verantwortung – auch bei der Nutzung Sozialer Netzwerke. Angesichts offensichtlicher datenschutzrechtlicher Defizite bei einer Reihe Sozialer Netzwerke sollen die öffentliche Stellen ihre dortigen Angebote zukünftig auf Datensparsamkeit bei der Verarbeitung von Nutzungsdaten und auf eine aktive Information der Nutzerinnen und Nutzer über die angesprochenen Gefahren für deren persönliche Daten ausrichten. Fehlende Widerspruchsmöglichkeiten bei Sozialen Netzwerken selbst sind durch Maßnahmen der öffentlichen Stellen wie Information und Aufklärung, einen Hinweis auf die eigenverantwortliche Nutzung und auf das Angebot alternativer Kommunikationskanäle zu kompensieren, um die Nutzerinnen und Nutzer in die Lage zu versetzen, über ihre Daten tatsächlich selbst zu bestimmen.
II. Vorgaben und Voraussetzungen
Aus Sicht des LfDI haben öffentliche Stellen bei einer Nutzung Sozialer Netzwerke daher folgende vier Punkte zu berücksichtigen: Es muss 1. ein Nutzungskonzept festgelegt werden, 2. sind die Pflichten nach dem TMG einzuhalten, 3. muss die öffentliche Stelle ihren Auftritt kontinuierlich betreuen und 4. sind alternative Informations- und Kommunikationswegeanzubieten.
1. Klares Konzept
- Vor der Nutzung eines Sozialen Netzwerks muss die öffentliche Stelle ein Konzept erstellen, welches Zweck, Art und Umfang der vorgesehenen Nutzung Sozialer Netzwerke durch die öffentliche Stelle beschreibt, die Gründe der Entscheidung für das gewählte Soziale Netzwerk darstellt sowie Verantwortlichkeiten für die redaktionelle/technische Betreuung und die Wahrnehmung der Rechte der Betroffenen nach Art. 15 ff. der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) festlegt. Dabei muss erkennbar sein, welche Vorteile sich die jeweilige Stelle für ihre Aufgabenerfüllung durch die Nutzung erhofft bzw. welche Nachteile durch einen Verzicht entstehen würden. Dieses Konzept bildet die Grundlage für zukünftige Prüfungen des LfDI.
- Die jeweiligen Nutzungszwecke führen notwendig zu Differenzierungen, die sich im Konzept wiederfinden müssen: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eines Ministeriums können andere Schwerpunkte zum Tragen kommen als bei der Öffentlichkeitsarbeit einer Verbandsgemeinde oder der Öffentlichkeitsarbeit zum Zweck der Nachwuchsgewinnung. Auch können sich Unterschiede im Hinblick auf den Umfang der intendierten Nutzung ergeben, je nachdem, ob nur eine bloße Information oder auch eine Kommunikation mit den Bürgern vorgesehen ist. Insbesondere bei letzterer ist auf einen sorgfältigen Umgang gerade auch mit sensiblen Daten zu achten.
- Im Rahmen des Konzepts ist auch eine Abschätzung der Konsequenzender vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten, vorzunehmen. Eine Meldepflicht gegenüber dem LfDI besteht insoweit in der Regel nicht – aber wir beraten natürlich gerne.
- Das Konzept sollte anhand der gemachten Erfahrungen regelmäßig, mindestens jährlich auf Erforderlichkeit und Ausmaß der Nutzung des Sozialen Netzwerks evaluiert werden.
- Das entwickelte Konzept und dessen Evaluation sind allgemein zugänglich zu machen, etwa nach Vorbild des § 11 Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) im Internet zu veröffentlichen.
2. Gestaltung des eigenen Netzwerk-Angebots: TMG-Pflichten beachten!
- Das eigene Angebot muss Angaben gemäß § 5 TMG enthalten, welche die öffentliche Stelle als Anbieter erkennen lassen. Diese Angaben müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Dem wird entsprochen, wenn die Angaben als „Impressum“ oder „Kontakt“ bezeichnet werden, im allgemeinen Navigationsmenü als eigener Punkt untergebracht und mit maximal zwei Schritten erreichbar sind.
- Das Angebot muss über eine eigene Datenschutzerklärung verfügen, die als solche zu bezeichnen ist und wie das Impressum im Navigationsmenü als eigener Punkt untergebracht sein sollte, im Gegensatz zu diesem aber von jeder Seite des Angebots, also in einem Schritt, erreichbar sein muss. Zudem muss sie das eingangs beschriebene gestufte Anbieterverhältnis widerspiegeln:
- So muss die Datenschutzerklärung die Nutzerinnen und Nutzer einerseits über eine Verarbeitung von Nutzungsdaten durch den Plattformbetreiber und eine etwaige Übermittlung der Daten außerhalb der Europäischen Union unterrichten; dabei ist auch auf die Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers zu verlinken und auf die bei Sozialen Netzwerken bestehenden datenschutzrechtlichen Probleme sowie auf bestehende Möglichkeiten, die Verarbeitung von Nutzungsdaten einzuschränken, hinzuweisen (Datenschutz-/Privatsphäreneinstellungen des jeweiligen Sozialen Netzwerks). Wenn bei dem genutzten Sozialen Netzwerk keine dauerhaft verfügbare Datenschutzerklärung bereitgestellt werden kann, ist den Nutzerinnen und Nutzern ein regelmäßiger Hinweis auf diese zu geben (abhängig von der Häufigkeit neuer Inhalte jedenfalls monatlich), verbunden mit einem entsprechenden Link auf den Text der eigenen Datenschutzerklärung. Außerdem soll auf die Eigenverantwortung der registrierten Nutzerinnen und Nutzer für die Inanspruchnahme der Social-Media-Dienste Bezug genommen und ein Hinweis auf die bestehenden alternativen Informations- und Kommunikationswege gegeben werden, also z.B. die E-Mail-Adresse der Behörde oder die Behörden-Webseite. Soweit Mechanismen zum Einsatz kommen, mit denen durch den Plattformbetreiber eine Nutzung außerhalb desjeweiligen Sozialen Netzwerks erfasst werden kann (z.B. Cookies, Social Plug-Ins), sind die Nutzerinnen und Nutzer auch auf diese hinzuweisen, z.B. mittels eines entsprechenden Cookie-Banners oder Hinweis-Textes. Bei der Verwendung von Social Plug-Ins ist die 2-Klick- bzw. die Shariff-Lösung zu verwenden. Sind Plug-Ins auf diese Weise implementiert, werden nicht schon mit dem Aufruf der Internetseite personenbezogene Daten übermittelt, sondern erst nach Aktivierung des Plug-Ins per Mausklick. Der öffentlichen Stelle obliegt hier eine eigene Informations-und Prüfpflicht.
- Andererseits muss die Datenschutzerklärung eine Unterrichtung nach § 13 TMG enthalten (Art, Umfang, Zweck der Verarbeitung), soweit über das Soziale Netzwerk personenbezogene Daten durch die öffentliche Stelle selbst erhoben und verarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sind die Vorgaben nach Artt. 44 ff. DSGVO zu beachten (Datenübermittlung ins Ausland). Die öffentliche Stelle trägt dabei eine Mitverantwortung für die Erhebung von Daten durch das Soziale Netzwerk über die Personen, die die Seite des Netzwerks besuchen; werden durch das Soziale Netzwerk z.B. personenbezogene Daten mittels Cookies erhoben und daraus Besucherstatistiken für die öffentliche Stelle erstellt, so trägt die öffentliche Stelle für diese Erhebung eine Mitverantwortung und muss Besucher ihrer Netzwerk-Seite auf diese Erhebung hinweisen.
3. Kontinuierliche Betreuung des eigenen Angebots
Gemäß § 7 Abs. 1 TMG sind Diensteanbieter grundsätzlich nur für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, verantwortlich, nicht jedoch für fremde Inhalte und Datenverarbeitungen. Dies hat zur Folge, dass ein Diensteanbieter nicht verpflichtet ist, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Besteht jedoch seitens der Nutzer die Möglichkeit, im Rahmen des Angebots der öffentlichen Stelle interaktiv teilzunehmen (z.B. durch Kommentare), und erlangt die öffentliche Stelle Kenntnis von einer rechtswidrigen Handlung oder Information, so haftet sie nach § 10 TMG, wenn sie nicht unverzüglich tätig wird und die Informationen entfernt. Die öffentliche Stelle muss ihr Angebot daher – ihrem Konzept entsprechend – von einer entsprechend geschulten Person redaktionell betreuen lassen. Übernahme von Verantwortung bedeutet auch, in dem genutzten Sozialen Netzwerk regelmäßig (mindestens einmal im Quartal) Aktionen zur Sensibilisierung der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich der Risiken für ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchzuführen. Dies kann beispielsweise durch Hinweise auf aktuelle Datenschutzthemen, auf Beiträge zum Datenschutz oder durch Hinweise auf entsprechende Informationsangebote erfolgen.
4. Alternativen anbieten
- Grundsätzlich darf der Zugang zu Informationen der öffentlichen Stelle nicht von einer vorherigen Registrierung bei einem Sozialen Netzwerk abhängig sein. Außer über das Soziale Netzwerk müssen die bereitgestellten Informationen daher immer auch auf einem alternativen Weg verfügbar sein (z.B. Webseite der Verwaltung). In keinem Fall darf eine Situation entstehen, in der Nutzerinnen und Nutzer veranlasst werden, ein Soziales Netzwerk nur deswegen zu nutzen, weil sie nur dort bestimmte staatliche oder kommunale Informationen bekommen.
- Das Angebot von Alternativen gilt besonders im Hinblick auf die Nutzung interaktiver Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten). Diese geht über ein reines Informationsangebot hinaus und steht weitgehend in der Verantwortung der Nutzerinnen und Nutzer. Soweit die Funktionen darauf ausgerichtet sind, in einen intensivierten Dialog mit der öffentlichen Stelle zu treten, ist immer auch eine alternative Kommunikationsmöglichkeit außerhalb des Sozialen Netzwerks anzubieten (z.B. E-Mail/Telefon). Die öffentliche Stelle kann nach Maßgabe der Erforderlichkeit interaktive Funktionen nutzen, etwa auf aktuelle Geschehnisse und Gefahrenlagen hinweisen, auf Kommentare und Fragen antworten und Kommunikation moderieren, wenn Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten so weit wie möglich vermieden werden und auf die Nutzung alternativer Wege nachdrücklich hingewirkt wird.
III. Ausblick
Damit steht aus Sicht des LfDI ein Handlungsrahmen zur Verfügung, mit dem Erwartungen von Nutzerinnen und Nutzern an eine Beteiligung öffentlicher Stellen an Sozialen Netzwerken entsprochen werden kann und der trotz weiterhin offener Punkte anerkannte Datenschutzstandards wirksam werden lässt.
Europäische Rechtsvorschriften zum Datenschutz, die seit Mai 2018 wirksam sind, erlegen den Anbietern von Sozialen Netzwerken weit reichende Pflichten, insbesondere auch hinsichtlich der Transparenz und der Information des Einzelnen auf. Dies hat auch bei öffentlichen Stellen, die Soziale Netzwerke nutzen, bereits zu Anpassungen geführt. Die dynamische Entwicklung in diesem Bereich wird für weiteren Anpassungsbedarf sorgen. Der LfDI beobachtet diese Entwicklung und wird auch zukünftig Beratung und Unterstützung anbieten.
Beitrag online gestellt am 20.08.2025. Inhaltlicher Stand: Februar 2020